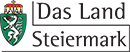Richtlinie zur Beurteilung
Einleitung
Zu den Pflichten der behördlichen Forstaufsicht zählt gemäß § 172 Abs. 4 Forstgesetz 1975 i.d.g.F. (FG) u.a. auch die Feststellung von Forstschäden durch Wild.
Gemäß Art. 15 Abs. 1 der Bundesverfassung fallen alle Maßnahmen zum Schutz des Waldes vor Wildschäden in Gesetzgebung und Vollziehung in die Zuständigkeit der Länder. Daher bleibt die Verantwortlichkeit der Jagdbehörden für die Vollziehung der Jagdgesetze von ggstdl. Richtlinie unberührt
Mit der Richtlinie wird der Begriff "flächenhafte Gefährdung des Bewuchses durch jagdbare Tiere" gem. § 16 Abs. 5 FG bundeseinheitlich festgelegt; damit soll eine bundesweit gleiche Vorgangsweise mit gleichen Schwellenwerten für das Einschreiten des Forstaufsichtsdienstes nach § 16 Abs. 5 FG gewährleistet werden. Das heißt, dass bei Überschreitung der Schwellenwerte der Richtlinie jedenfalls eine flächenhafte Gefährdung des forstlichen Bewuchses vorliegt
Es wird festgehalten, dass der Begriff "flächenhafte Gefährdung ..." im rechtssystematischen Zusammenhang mit anderen forstgesetzlichen Bestimmungen zu interpretieren ist, wie dies in der Richtlinie bei der Festlegung der Schwellenwerte erfolgt ist, wo jene Kriterien herangezogen werden, bei deren Vorliegen sich Waldflächen als besonders schutzwürdig darstellen: 0,5 ha /bewilligungspflichtige Fällung; 2 ha/Großkahlhieb; 0,2 ha/bewilligungspflichtige Fällung im Schutzwald; 60 % Überschirmung/Einzelstammentnahme usw.
Der Rahmen für die Beurteilung der flächenhaften Gefährdung und damit für die Erstellung von Gutachten gemäß § 16 Abs. 5 FG wird durch das Forstgesetz und nicht durch forstbetriebliche Zielvorgaben abgesteckt. Bei der Erstellung der Richtlinie wurde davon ausgegangen, dass das Forstgesetz jedenfalls standortstaugliche Baumarten fordert, die Vorschreibung einer standortsgerechten Baumartenmischung aber nur bei Schutz- und/oder Bannwäldern ableitbar ist.
Nicht jeder Wildschaden stellt eine flächenhafte Gefährdung des Waldes dar. Diese kann nur auf tatsächlich geschädigten Flächen (tatsächlicher Verjüngungsbedarf etc.) und nicht auf potentiell gefährdeten Flächen (quasi pro futuro) auftreten. Eine "flächenhafte Gefährdung des Bewuchses" (und damit eine Waldverwüstung) liegt jedenfalls dann noch nicht vor, wenn einzelne Bäume durch Schälung oder Verbiss beschädigt sind. Das heißt, dass außer den durch Verbiss bzw. Schälung eingetretenen Beschädigungen des forstlichen Bewuchses auch andere Tatbestandsmerkmale vorliegen müssen.
Die forstlichen und ökologischen Auswirkungen der Wildschäden, insbesondere der Verbissschäden, hängen von zahlreichen Faktoren ab und sind daher stets örtlich und standortsbezogen zu beurteilen. Bei jeder Meldung über eine flächenhafte Gefährdung des Bewuchses ist eine gutachtliche Beurteilung vor Ort durch den Forstaufsichtsdienst unbedingt notwendig. Die Erfassung der Gefährdungsfälle hat nach Lage, Flächenausmaß und Art der Gefährdung nachvollziehbar und schlüssig zu erfolgen.
Für die Anwendung des § 16 Abs. 5 FG ist nicht der aktuelle Wildstand maßgebend, sondern der gutachtlich nachweisbare Wildschaden bzw. die Schadensentwicklung in den letzten Jahren.